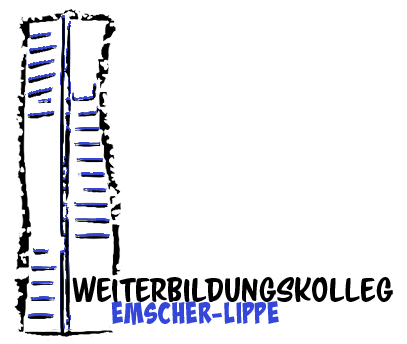„Diese Fahrt hat mich verändert“, schrieb eine Teilnehmer*in unserer Studienfahrt zum KZ Durchgangslager Westerbork. Und auch die anderen Studierenden aus dem ersten Semester bringen prägende Erfahrungen vom 26.9.2025 mit nach Hause, wie die Feedbacks rechts zeigen.
Ein Großteil der Jüd*innen in den Niederlanden, die nach der Besetzung durch Deutschland nicht rechtzeitig fliehen oder untertauchen konnten, wurde in das Durchgangslager verschleppt. Insgesamt waren das 104.000 Menschen.
Westerbork war ein Lager voller Widersprüche. Zwar war das Essen knapp und viele Gefangene mussten in Stockbetten in engen Baracken zusammenleben, aber niemand wurde in dem Lager ermordet. Im Gegenteil: Es gab dort ein sehr gutes Krankenhaus und eine Schule für die Gefangenen. Jüdische Feste konnten in bescheidenem Rahmen gefeiert werden. Aber über diesem scheinbaren Rest von Normalität schwebte eine ständige Drohung: Ab 1942 fuhr jeden Dienstag ein Deportationszug in die Todeslager Auschwitz und Sobibor oder die Konzentrationslager Ghetto Theresienstadt und Bergen-Belsen.
Heute sind von dem Lager nur noch recht wenige Spuren übrig, wie Teile einer Baracke, Reste der Zäune und Gräben sowie das Haus des Kommandanten.
Unserer hervorragenden Guide gelang es, ausgehend davon die Geschichte des Lagers anschaulich darzustellen. Besonderen Wert legte sie darauf, die Inhaftierten nicht Jüd*innen zu nennen, sondern Niederländer*innen. Denn es waren Freundinnen, Nachbarn und Kolleginnen. Ein Teil von ihnen war gläubig, andere nicht und wieder andere verstanden sich gar nicht als jüdisch. Erst der nationalsozialistische Rassismus machte aus ihnen eine angebliche jüdische Rasse, die von den anderen Niederländern unterschieden wurde.
Auch erklärte sie, dass es in den Niederlanden neben Widerstand auch Kollaboration (Zusammenarbeit) mit der Besatzung gab. Dazwischen stand die Gruppe der Gleichgültigen. Gleichgültig waren Zuschauer*innen, die nicht unbedingt für den Antisemitismus waren, aber auch nichts dagegen sagten und das Morden so ermöglichten.
„Seid nicht gleichgültig!“, lautet das 11. Gebot, das die Auschwitzüberlebenden Roman Kent und Marian Turski formulierten. Und das gilt auch heute, in Anbetracht von Kriegen, autoritärer Politik und Rassismus.
Wie andere durch sogenannte Arisierung vom Holocaust profitierten, erklärte unsere Guide am Beispiel der Familie Heymann, die ein kleines Warenhaus an der Karl-Meyer-Straße 29 in Gelsenkirchen-Rotthausen betrieb. Ab 1. Januar 1939 war es Jüd*innen verboten, Einzelhandelsgeschäfte zu betreiben und so waren sie gezwungen, den Laden billig abzugeben. Der Kaufmann Bernhard Strickling kaufte das Geschäft.
Herman und Erna Heyman sowie ihre Tochter Erna mussten 1939 in die Niederlande nach Assen fliehen. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 wurden sie über Westerbork und Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Während das Textilkaufhaus Strickling auf seiner Homepage diesen Teil der Vergangenheit des Unternehmens schönredet, hat eine Enkelin von Bernhard Strickling die Patenschaft für die drei Stolpersteine übernommen, die an die Familie Heymann erinnert. -> mehr dazu
Zur Vorbereitung der Fahrt nach Westerbork lernten die Studierenden im Geschichtsunterricht Hannelore Grünberg-Klein kennen. Sie wuchs in Berlin auf und ihre jüdische Schule konnte sie lange vom erstarkenden Antisemitismus abschirmen. Als in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe zerstört wurden, erkannte ihre Familie jedoch, dass sie fliehen musste. Ein Fluchtversuch mit dem Schiff St. Louis nach Kuba scheiterte, weil die kubanische Regierung die Menschen nicht an Land ließ. Die rassistische Stimmung im kubanischen Wahlkampf war stärker als die Verbindlichkeit der zuvor erteilten Visa.
Asyl fand die Familie Klein dann in den Niederlanden. Dort war sie aber nicht lange sicher. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 wurden sie in Westerbork interniert. Sie gehörten zu einer kleinen Anzahl von Gefangenen, die lange in Westerbork blieben. Deshalb kann sie in ihren Memoiren ein vielfältiges Bild des Lagers zeichnen.
Interessant ist, wie sie das widersprüchliche Verhalten der Kommandanten beschreibt. Von Juli 1940 bis Juli 1942 war der Niederländer Jacob Schol Kommandant von Westerbork. Über diesen schrieb Hannelore Klein-Grünberg: „Schol war ein guter Kommandant, antideutsch und anti-Nazi. Er versuchte, es den Menschen so angenehm wie möglich zu machen.“ Schol hoffte, durch eine perfekte Organisation des Lagers die Deutschen davon abzuhalten, selbst die Kontrolle zu übernehmen. Deshalb erfüllte er die deutschen Wünsche und nahm die Bewachung der Gefangenen sehr ernst und zwang diese morgens und abends zum Appellstehen. -> Mehr Infos zu Schol https://kampwesterbork.nl/de/geschichte/zweiter-weltkrieg/fluechtlingslager/70-zweiter-weltkrieg/fluechtlingslager/288-1940-1942.
Der spätere Kommandant, der Düsseldorfer Albert Konrad Gemmeker, war ein SS-Obersturmführer und seine höchste Priorität war es, die Deportation so reibungslos wie möglich durchzuführen. Deshalb legte auch er Wert auf verhältnismäßig zivilisierte Zustände im Lager, um Widerstand zu verhindern. Lagerinsassen nannten ihn gelegentlich einen „Gentleman-Kommandanten“ oder sagten, dass er seine Opfer nicht mit dem Stiefel in die Todeslager getreten habe, sondern sie nach Polen gelächelt habe.
Anfang 1944 wurden Hannelore Klein und ihre Familie dann nach Theresienstadt und weiter nach Auschwitz deportiert. Ihre Eltern wurden ermordet, Hannelore überlebte und traf nach der Befreiung ihre Großeltern, ihre Tante und ihre Nichte wieder, die ebenfalls überlebten. 1950 entschloss sie sich, nach Israel auszuwandern, kehrte aber nach kurzer Zeit in die Niederlande zurück, um für ihren schwer erkrankten Großvater zu sorgen. Sie heiratete Hermann Grünberg, der wie Hannelore einen großen Teil seiner Familie im Holocaust verloren hatte. Mit ihm hatte sie zwei Kinder. Später schrieb sie ihre Memoiren. 2015 starb sie im Alter von 87 Jahren.
Wir danken ganz herzlich dem Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen und der Stadt Gelsenkirchen für die Finanzierung der Fahrt als Beitrag zur Prävention von Antisemitismus.
„Das Museum fanden wir sehr interessant. Es gab schöne und auch traurige Ausstellungsstücke.“
„Am meisten hat mich schockiert, dass die Nazis eine Scheinwelt erschaffen hatten, um die Menschen zu täuschen und die ganze Sache zu verharmlosen.“
„Das Lager vermittelt nähere Eindrücke, wie die Juden ihre Zeit in Westerbork verbrachten.“
„Mir haben die kleinen Grabsteine gefallen, die an die Opfer, die keine Gräber haben, erinnern.“
„Im Museum war ich ergriffen von den Koffern mit den Geschichten und Gegenständen der Gefangenen.“
„Am bemerkenswertesten fand ich das Denkmal draußen, das für all die toten Menschen steht.“
„Das nachgestellte Zimmer fand ich besonders beeindruckend. Es gab da eine silberne Herzkette, die mich ergriffen hat, und ich fragte mich, wem sie wohl gehört hat.“
„Die Führung war eine Konfrontation mit der Vergangenheit und dem aktuellen Weltgeschehen. „
„Die Geschichte mahnt uns: Nie wieder ist jetzt!“
„Ich war erschüttert, dass die Roma als Untermenschen gesehen und noch schlechter behandelt wurden, als die Juden.“
„Mich hat beeindruckt, wie die Geschichten im Museum künstlerisch untermalt wurden.“
„Auch wenn nicht mehr viel übrig ist von dem Gelände, so ist die Vorstellung, wie es wohl gewesen ist, unfassbar bedrückend.“
„Die hingerichteten Menschen wollten nur leben und arbeiten, wie andere auch.“
„Ich habe zudem viel Ähnlichkeit zwischen den jüdischen Kindern und meiner Kindheit entdeckt.“
„Das Mahnmal mit den zerstörten Gleisen und den weißen Steinen, die für diejenigen stehen, die damals nur tatenlos zugeschaut haben, hat mich fasziniert.“
„Durch die ausführlichen Beschreibungen und die vielen Bilder wurden die Menschen greifbar für mich. Auch die künstlerische Gestaltung war sehr beeindruckend.“
„Diese Fahrt hat mich verändert.“
„Das Museum ist sehr interessant, da die vielen Texte, Fotos und persönlichen Gegenstände die Geschichte lebhaft beschreiben.“
„Das ehemalige Durchgangslager Westerbork ist ein Tor in die Vergangenheit, das zeigt, wie durch z.B. Sport- und Musikveranstaltungen den späteren Todesopfern eine heile Welt vorgespielt wurde.“